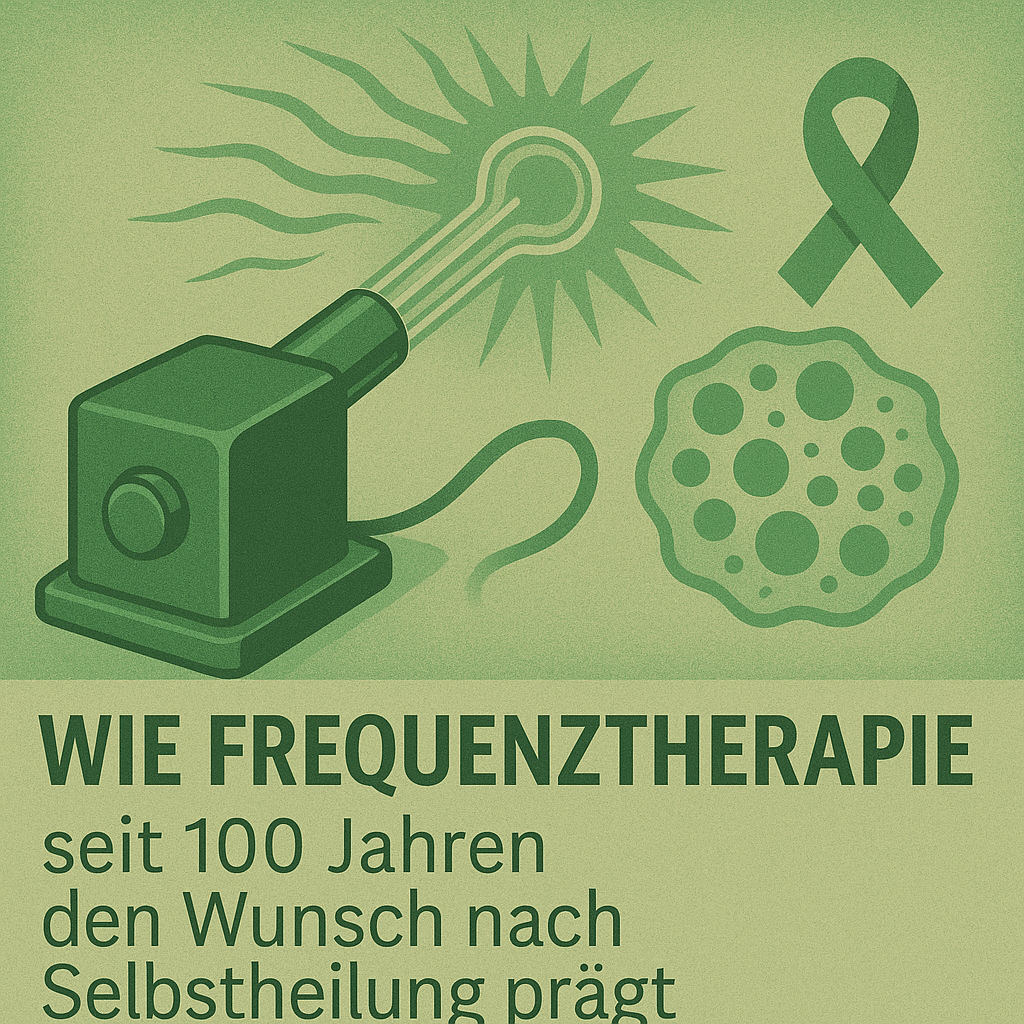
Auf der Frequenz der Zeit: Die faszinierende Geschichte der Elektrotherapie
Einleitung: Wenn Heilung durch Strom kommt
Schon die Namen der Apparate klangen verheißungsvoll: PHÖNIX, Heliolux, Philantrop. Ihre Erscheinung erinnerte an edles Design, ihre Versprechen an Wunder: Linderung bei Gelenkschmerzen, Asthma, Haarausfall – bequem zu Hause, ohne Arzt. In der Zwischenkriegszeit erlebten Hochfrequenzgeräte eine erstaunliche Karriere, zwischen medizinischem Heilsversprechen und elektrifiziertem Lifestyle.
Elektrotherapie als Lifestyle-Produkt
Bereits in den 1920er-Jahren entwickelten sich Hochfrequenzgeräte zum Konsumgut für den Privathaushalt. Mit Glas-Elektroden gefüllt mit Edelgasen, leuchteten sie orange, violett oder blau, erzeugten geheimnisvolle Geräusche und ein angenehmes Prickeln auf der Haut. Ihre Handhabung war einfach, ihr Nutzen scheinbar universell. Besonders die visuelle und akustische Ästhetik verstärkte die suggestive Wirkung der Anwendungen – ganz im Sinne eines neuen Selbstverständnisses von Heilung als Erlebnis.
Zwischen Naturheilkunde, Lebensreform und Technikbegeisterung
Die Beliebtheit dieser Geräte lässt sich nur im Kontext der Zeit verstehen: Die sogenannte „Krise der Medizin“ – eine wachsende Skepsis gegenüber der Schulmedizin – ließ viele nach alternativen Heilwegen suchen. Die Lebensreformbewegung propagierte Ganzheitlichkeit, Vitalität und Körperkult. Elektrizität passte hier erstaunlich gut hinein: Sie galt als „Naturkraft“, als Energiequelle des Körpers, die über das Gerät zurückgegeben werden konnte.
Der "Wunderheiler" Valentin Zeileis
Populär wurde besonders Valentin Zeileis, ein Laientherapeut aus Österreich. In abgedunkelten Räumen mit elektrischen Lichtspiralen behandelte er bis zu 1.000 Menschen täglich. Seine Methode vereinte Selbstinszenierung, Hochfrequenzbestrahlung und Radiumtherapie zu einem spirituellen Erlebnis, das zwischen Kult und Kommerz angesiedelt war.
Technik als Selbstführung
Elektrotherapie diente in der Weimarer Republik auch der Selbstoptimierung: Gesundheit wurde zur privaten Verantwortung, zur sozialen Pflicht. Die Geräte wanderten in Friseursalons, Kosmetikstuben und private Badezimmer und waren Symbol für Disziplin und Modernität. Sie standen für ein neues Gesundheitsbild – zwischen Selbsthilfe, Hygiene und Lifestyle.
Von Boom zur Verdrängung
Obwohl die Geräte teuer waren, fanden sie weite Verbreitung. Doch mit dem NS-Regime, medizinischen Fortschritten wie Antibiotika und dem Aufkommen des Fernsehens verloren sie an Bedeutung. Dennoch verschwanden sie nie ganz und leben heute in Wellnessangeboten und naturheilkundlichen Anwendungen fort.
Fazit: Der Strom der Geschichte
Hochfrequenztherapie steht sinnbildlich für eine Epoche, in der Technik, Gesundheit und Kultur auf neue Weise zusammenfanden. Die Geschichte dieser Geräte zeigt, wie sich Gesellschaften durch Technologie, Körperbilder und Heilsversprechen formen lassen. Und sie zeigt, wie aktuell manche dieser Fragen noch heute sind.
